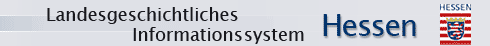Historisches Ortslexikon
- Messtischblatt
- 4826 Eschwege
- Moderne Karten
- Kartenangebot der Landesvermessung
- Topografische Karten
- KDR 100, TK25 1900 ff.
- Urkataster+
- Eschwege
- Historische Karten
- Kurfürstentum Hessen 1840-1861 – 35. Eschwege
Weitere Informationen
Eschwege
-
Stadtteil · 160 m über NN
Gemeinde Eschwege, Werra-Meißner-Kreis
- Siedlung ↑
-
Ortstyp:
Stadt
-
Lagebezug:
40 km ostsüdöstlich von Kassel gelegen
-
Lage und Verkehrslage:
Komplexe Stadt mit regelhaften Grundrissmerkmalen am südlichen Ufer der mittleren Werra in einer weiten ost-westlich ausgerichteten, gleichnamigen Beckenlandschaft. Vorstadt Brückenhausen nördlich auf einer Insel. Kern der Altstadt mit rippenförmigem Straßennetz, Obermarkt und Marktkirche (St. Dionys) am Südhang des Cyriakusberges, wo sich das ehemalige Kanonissenstift St. Cyriakus befand. Hieran nach Südosten anknüpfend Neustadt (1306/1357) mit gitterförmigem Straßennetz, rechteckigem Markt und Kirche (St. Katharina). Mittelalterliche Stadtmauer um den elipsenförmigen Stadtgrundriss mit 7 Toren und 16 Türmen im 19. Jahrhundert niedergelegt. Dreiflügeliges Schloss (heute Landratsamt) im Westen der Altstadt auf einer Buntsandsteinterrasse über dem südlichen Werraufer, Klosteranlage im Westen. Erweiterung der Stadt nach 1945 durch Industriegelände auf der ehemaligen Flugwerft in Richtung Niederhone. Moderne Wohnsiedlungen ebenfalls Richtung Westen, nach Osten in Richtung Leuchtberg sowie nach Süden.
Die mittelalterliche W-O-Verbindung vom Niederrhein über Kassel und Mühlhausen nach Leipzig und Dresden führt im Westen von Eschwege über die älteste Straße Am Stad und die Werrabrücke. Chausseen nach Bischhausen, Bad Sooden-Allendorf und Wanfried. Im Stadtgebiet treffen die Bundesstraßen B249 und B452 aufeinander; darüber hinaus ist Eschwege über die Landesstraßen L3424, L3300 und L3244 an das Straßenverkehrsnetz angebunden.
Bahnhof der Eisenbahnlinie Eschwege/Niederhone – Leinefelde ("Kanonenbahn I") seit 1875 (Die Teilstrecke Eschwege/Niederhone - Eschwege wurde am 31.10.1875 eröffnet, die Teilstrecke Eschwege - Leinefelde am 15.5.1880).
-
Ersterwähnung:
974
-
Siedlungsentwicklung:
Der Königshof Eskiniuuach, über dessen Aussehen nichts bekannt ist, wird 974 erstmals urkundlich erwähnt, als Kaiser Otto II. ihn als nachträgliche Morgengabe seiner Gemahlin, der byzantinischen Prinzessin Theophanu, schenkt. Diese bittet aber später ihren Sohn Otto III., den Besitz seiner Schwester Sophie zu überlassen, die Äbtissin von Gandersheim war. Die Übergabe ereignet sich 994 und vermutlich hat die Äbtissin dann an der Stelle des Königshofes das Cyriaxkloster einrichten lassen, das später für einige Zeit dem Stift Gandersheim unterstellt.
1928 erfolgt die Eingemeindung von Teilen des aufgelösten Gutsbezirks Vogelsburg.
-
Historische Namensformen:
- Eskiniuuach (974) [MGH Diplomata Könige 2,1, Otto II. : Sickel, S. 92-93 Nr. 76 Digitalisat]
- Eskiniuuag (994) [MGH Diplomata Könige 2,2, Otto III. : Sickel, S. 556-557, Nr. 146 Digitalisat]
- Escinevuage, actum (997) [MGH Diplomata Könige 2,2, Otto III. : Sickel, S. 665-666, Nr. 249 Digitalisat]
- Eschonouuaga, actum (997) [Druck 17. Jh. MGH Diplomata Könige 2,2, Otto III. : Sickel, S. 666-667, Nr. 250 Digitalisat]
- Eskeneuuage, actum (1040) [MGH Diplomata Könige 5, Heinrich III. : Bresslau, S. 79-80, Nr. 61
- Digitalisat]
- Aeskinewag (1043) [Unvollzogene Gandersheimer Empfängerausfertigung MGH Diplomata Könige 5, Heinrich III. : Bresslau, S. 539-541, Nr. 390 Digitalisat]
- Digitalisat]
- Eschenevvage, actum (1057) [MGH Diplomata Könige 6, Heinrich IV. : Gladiss, S. 36-37, Nr. 30 Digitalisat]
- Eschinwanch, in (zu 1060) [2. Hälfte 12. Jahrhundert W. Wattenbach (Hrsg.), Vita Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis, in: MGH SS 11, S. 35 Digitalisat]
- Eschinewage, in (1075) [Abschrift Ende 13. Jahrhundert MGH Diplomata Könige 6, Heinrich IV. : Gladiss, S. 354-355, Nr. 277Digitalisat]
- Eschenewege (1077-1080; zu 1073) [1. Hälfte 12. Jahrhundert Lampert von Hersfeld, Opera, MGH SS rerum Germanicarum 38, Annales, S. 156 Digitalisat]
- Heschenewege, ultra, ab, in (1077-1080; zu 1070) [Handschriften und Drucke 15./16. Jahrhundert Lampert von Hersfeld, Opera, MGH SS rerum Germanicarum 38, Annales, S. 116 Digitalisat]
- Eskeneweg, iuxta (1070) [J. Prinz (Bearb.), Corveyer Annalen, S. 130]
- Eschinewach, in (1101) [Abschrift 15. Jahrhundert MGH Diplomata Könige 6, Heinrich IV. : Gladiss, S. 629-632, Nr. 466 Digitalisat]
- Askinewage, iuxta; Askinwage, iuxta (Anfang 12. Jahrhundert; zu 1070) [G. H. Pertz (Berab.), Annales Ottenburani, in: Monumenta Germaniae Historica SS 5, S. 7 Digitalisat]
- Eschinewach (1140) [Abschrift um 1280 MGH Diplomata Könige 9, Konrad III. : Hausmann, S. 70-73, Nr. 43 Digitalisat]
- Eskenewege (1149) [M. Hartmann (Hrsg.), Briefbuch Abt Wibalds von Stablo und Corvey 1, Monumenta Germaniae Historica. Epistolae 2, Die Briefe der deutschen Kaiserzeit 9,1, S. 226-254, Brief Nr. 124, hier S. 247 Digitalisat]
- Eschenwege, de (um 1150) [R. Hoeniger, Kölner Schreinsurkunden des zwölften Jahrhunderts 2,2, S. 47]
- Eskenwege (1152/53) [C. Brühl/T. Kölzer, Tafelgüterverzeichnis des römischen Königs, S. 51-53]
- Eschenwegensis (1184) [Abschrift um 1430 MGH DD F I. 4, Appelt, S. 100, Nr. 863; Digitalisat]
- Eschenwege, in (1188) [Transsumpt 1505 MGH DD F I. 4, Appelt, S. 252-253, Nr. 972; Digitalisat]
- Eschenewegen (1198/99) [Eckhardt, Rechtsgeschichte der Stadt Eschwege 1, S. 22-23, Nr. 21]
- Escenewege, apud (um 1213) [Eckhardt, Rechtsgeschichte der Stadt Eschwege 1, S. 24-25, Nr. 23]
- Eschenwege (1292) [Eckhardt, Rechtsgeschichte der Stadt Eschwege 1, S. 36-37, Nr. 39]
- Eskenewege, versus (1297) [Urkundenbuch Reichsstadt Mühlhausen, S. 202-203, Nr. 469]
- Esscenewege (1301) [Landgrafen-Regesten online Nr. 431]
- Eschwege (1436) [Eckhardt, Rechtsgeschichte der Stadt Eschwege 1, S. 173-178, Nr. 183]
- Eschwege (1585) [Der ökonomische Staat, S. 79]
- Esweghen (1708/10) [Schleenstein, Landesaufnahme, Karte Nr. 10]
-
Bezeichnung der Siedlung:
- civitas; curtis (974)
- predium (994 und 1075)
- locus (1060)
- curtis; abbacia (1101 und 1140)
- villa (1188)
- burgenses oppidi de Escheneweg (1236) [Huyskens, Klöster an der Werra, Text Nr. 24]
- villa regia (1250) [Eckhardt, Rechtsgeschichte der Stadt Eschwege 1, S. 28-29, Nr. 28]
- civitas (1277) [Huyskens, Klöster an der Werra, Nr. 25]
- opidum (1292)
- Stad (1436)
-
Siedlungsplätze innerhalb der Gemarkung:
- An der Krücke
- Brückenhausen
- Burg Leichberg
- Forsthaus Schlierbach
- Friedrichsruh
- Heiliggeist-Siechenhaus
- Leichberg (Hof)
- Leuchtberg-Felsenkeller
- Leuchtberghalle
- Oberschlierbach
- Sankt Ottilien
- Schlierbach
- Schlierbachsmühle
- Schloßmühle
- Staufenbühl
- Vogelsburg
- Vornde
- Augustinereremitenkloster Eschwege (→ Klöster)
- Benediktinerinnen St. Cyriacus Eschwege (→ Klöster)
- Haus der Witzenhäuser Wilhelmiten in Eschwege (→ Klöster)
- Heydauer Hof in Eschwege (→ Klöster)
- Propstei des Zisterzienserklosters Reifenstein in Eschwege (→ Klöster)
- Vinzentinerinnen (Barmherzige Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul) in Eschwege (→ Klöster)
-
Burgen und Befestigungen:
-
Älteste Gemarkungskarte:
1745
-
Koordinaten:
Gauß-Krüger: 3573776, 5672748
UTM: 32 U 573673 5670918
WGS84: 51.184931° N, 10.054132° O OpenLayers - Statistik ↑
-
Ortskennziffer:
636003030
-
Flächennutzungsstatistik:
- 1885 (Hektar): 2954, davon 1411 Acker (= 47.77 %), 144 Wiesen (= 4.87 %), 1077 Holzungen (= 36.46 %)
- 1961 (Hektar): 3844, davon 1016 Wald (= 26.43 %)
-
Einwohnerstatistik:
- 1585: 733 Haushaltungen (Der ökonomische Staat)
- 1747: 800 Haushaltungen (Stadt- und Dorfbuch des Ober- und Niederfürstentums Hessen)
- 1769: 800 Gebäude, 3642 Einwohner, Gewerbetreibende, zünftig: 29 Gewandschneider und Krämer, 86 Schuhmacher, 26 Schneider, 34 Bäcker, 43 Metzger, 15 Schmiede und Schlosser, 13 Schreiner und Glaser, 11 Faßbinder, 21 Leinweber, 101 Tuch- und Raschmacher, 54 Lohgerber, 3 Büchesenmacher, 3 Zinngießer, 3 Blechschmiede, unzünftig: 4 Drechsler, 2 Schwarz- und Schönfärber, 3 Kupferschmiede, 4 Goldschmiede, 19 Schiffer, 23 Fuhrleute, 3 Chirurgen, 1 Bader, 2 Apotheker, 1 Gürtler, 5 Knopfmacher, 4 Strumpfweber, 4 Kürschner, ? Weißbinder, 4 Weißgerber, 9 Gastwirte, 8 Sattler, 4 Seiler, 3 Hutmacher, 6 Zimmerleute, ? Wagner, 1 Buchbinder, 3 Tuchpresser, ? Schnurmacher, 3 Töpfer, 4 Tabakspinner, 2 peruquier (Perückenmacher), ? Spennadelmacher, 8 Maurer, 1 Schornsteinfeger, 22 Höker und Krämer, ? Gärtner, 50 Tagelöhner, 8 Schäfer, 30 Schutz- und Handelsjuden, 3 Müller, 51 in keinem Gewerbe stehende Personen
- 1819: 4400
- 1885: 9492, davon 8602 evangelisch (= 90.62 %), 340 katholisch (= 3.58 %), 1 andere Christen (= 0.01 %), 549 Juden (= 5.78 %)
- 1895: 10285 Einwohner (gemäß Reimer) oder 1895: 2138 Haushaltungen mit 10111 Einwohnern, davon 1287 Landwirtschaft treibende Bürger sowie 439 Gewerbebetriebe (gemäß Jacob)
- 1961: 24091, davon 18215 evangelisch (= 75.61 %), 4815 katholisch (= 19.99 %)
- 1970: 22718 Einwohner
-
Diagramme:

Datenquelle: Historisches Gemeindeverzeichnis für Hessen: 1. Die Bevölkerung der Gemeinden 1834-1967.
Wiesbaden : Hessisches Statistisches Landesamt, 1968. - Verfassung ↑
-
Verwaltungsbezirk:
- 974: Land Thüringen, Germaramark in der Grafschaft des Grafen Wigger (in regione Turingia in Germarene marcha et in comitatu Vuiggeri comitis)
- 1075: Bistum Speyer
- 1233: Erzbistum Mainz
- 1250-1264: Herzogtum Braunschweig
- 1264: Landgrafschaft Hessen
- 1292: Landgrafschaft Hessen (nunmehr als Reichslehen)
- 1395: Anschluss der Stadt an den thüringischen Landgrafen Balthasar von Meißen
- 1433: Landgrafschaft Hessen, Niederhessen (Entgültige Abtretung durch Friedrich den Jüngeren von Meißen)
- 1585: Landgrafschaft Hessen, Niederhessen, Amt Eschwege
- 1627-1834: Landgrafschaft Hessen-Rotenburg (sogenannte Rotenburger Quart), teilsouveränes Fürstentum unter reichsrechtlicher Oberhoheit der Landgrafschaft Hessen-Kassel bzw. des Kurfürstentums Hessen
- 1787: Landgrafschaft Hessen-Kassel, Niederhessen, Amt Eschwege, Gericht Eschwege
- 1803-1806: Kurfürstentum Hessen, Niederhessen, Amt Eschwege, Gericht Eschwege
- 1807-1813: Königreich Westphalen, Departement der Werra, Distrikt Eschwege, Kanton Eschwege
- 1814-1821: Kurfürstentum Hessen, Niederhessen, Amt Eschwege, Gericht Eschwege
- 1821: Kurfürstentum Hessen, Provinz Niederhessen, Kreis Eschwege
- 1848: Kurfürstentum Hessen, Bezirk Eschwege
- 1851: Kurfürstentum Hessen, Provinz Niederhessen, Kreis Eschwege
- 1867: Königreich Preußen, Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Eschwege
- 1945: Groß-Hessen, Regierungsbezirk Kassel, Kreis Eschwege
- 1946: Land Hessen, Regierungsbezirk Kassel, Kreis Eschwege
- 1974: Land Hessen, Regierungsbezirk Kassel, Werra-Meißner-Kreis
-
Altkreis:
Eschwege
-
Gericht:
- 1834: Kurfürstliches Justizamt Eschwege I
- 1867: Amtsgericht Eschwege
- 1879: Amtsgericht Eschwege
-
Herrschaft:
Kaiser Otto II. schenkt 974 seiner Gemahlin Theophanu Burgen und Höfe im Land Thüringen, in der Germaramark und in der Grafschaft des Grafen Wigger gelegen, darunter auch Eschwege.
1075 gelangt das predium Eschwege mit der Abtei St. Cyriakus als Schenkung König Heinrichs IV. an die bischöfliche Kirche in Speyer und soll dort zum Unterhalt der Domherren beitragen. Das Domkapitel von Speyer veräußert 1233 Eschwege für 400 Mark an den Erzbischof von Mainz von Mainz.
1292 mit der Erhebung in den Reichsfürstenstand erhält Landgraf Heinrich I. von König Adolf von Nassau die Stadt Eschwege und die Boyneburg mit dem noch vorhandenen Reichsbesitz.
Im Zuge der Aufstände der Städte gegen die landgräfliche Politik stellt sich Eschwege 1385 unter den Schutz der thüringischen Landgrafen. 1433 tritt Friedrich der Jüngere von Meißen die Schlösser und Städte Eschwege, Sontra und Wanfried für 6000 Gulden endgültig an Landgraf Ludwig von Hessen ab.
Schultheiß (1236)
Amtmann (1283)
Stadt
Stadtwerdung ohne formale Erhebung 1236 bereits fortgeschritten (burgenses; cives; Eckhardt, Rechtsgeschichte der Stadt Eschwege 1, S. 25-28, Nr. 24-26). Rat auf 3 Jahre in der Regel aus 12 Mitgliedern, denen 2 als Ratsmeister (magister consulum 1278) vorstehen. 1370 soll der landgräfliche Amtmann 36 Personen bestimmen, aus denen der Rat gewählt wird. 1471 nach Konflikten zwischen Rat und Gemeinde gleichberechtigte Beteiligung der letzteren an der Besetzung der städtischen Ämter (Kämmerer, Baumeister, Braumeister) [Landgrafen-Regesten online Nr. 9654; Landgrafen-Regesten online Nr. 9655]. In der von Landgraf Wilhelm II. 1492 erlassenen Verfassungsänderung (Eckhardt, Rechtsgeschichte der Stadt Eschwege 1, S. 211-214, , Nr. 220) wird folgendes festgehalten: Die bisherige Stadtverfassung mit drei Ratsgremien, sechs Bürgermeistern und 30 Schöffen wird aufgehoben. An der Spitze der Stadt steht nun ein Rat mit zwölf Schöffen darunter zwei Bürgermeister, einer vom Landesherrn, einer von der Gemeinde gewählt. Im 18. Jahrhundert zwei regierende Bürgermeister, vier proconsules, 15 Ratsmitglieder, ein Syndikus
Ältestes Stadtsiegel 1261 angekündigt (sigillum civium de Eschenwege) [hierzu ausführlich Eckhardt, Rechtsgeschichte der Stadt Eschwege 2, S. 555-557]
-
Gemeindeentwicklung:
1.4.1936: Eingemeindung von Niederhone.
Am 31.12.1971 erfolgte im Zuge der hessischen Gebietsreform die Eingemeindung von Niederdünzebach und Oberdünzebach in die neu gebildete Stadtgemeinde Eschwege. Zu deren weiterer Entwicklung s. Eschwege, Stadtgemeinde. Sitz der Stadtverwaltung ist Eschwege.
- Besitz ↑
-
Grundherrschaft und Grundbesitzer:
- vgl. auch Herrschaft und Klöster
- Das auf Reichsgut auf dem gleichnamigen Berg für Kanonissen spätetestens im 11. Jahrhundert gegründete Cyriakusstift hat ursprünglich umfangreiche Rechte, Einkünfte und Grundbesitz. 1188 besitzt die Abtei nachweislich das Münz- und Marktrecht sowie das Gericht in Eschwege. Seit dem 13. Jahrhundert müssen die Kanonissen Rechte zunächst an die Augustinereremiten und dann vor allem an die Landgrafen abtreten.
- Die vom Stift Gandersheim im 12. Jahrhundert behaupteten Ansprüche auf Eschwege, denen zufolge Sophie, die Gründerin des Cyriakusstiftes in Eschwege, dieses nun Gandersheim übertragen zu haben, entbehren einer historischen Grundlage. Vielmehr sollten auf diese Weise fehlende Besitztitel hergestellt werden.
- Die 1278 in Eschwege angesiedelten Augustineremiten erhalten von der Äbtissin des Cyriakusstifts Kunigunde ein Grundstück und können 1326 ihren Besitz um eine Fläche gegenüber ihrer Kirche erweitern. 1527 werden sie finanziell von den Landgrafen abgefunden.
- Das Kollegiatstift Großburschla hat Grundbesitz in Eschwege und erhält Ende des 14. Jahrhunderts die Seelsorge an der Pfarrkirche St. Gotthard.
- Das Kloster Heydau bei Altenmorschen besitzt 1331 Haus und Hof vor dem Berg über der tiefen Gasse und wird vom Stadtrat in diesem Jahr von städtischen Lasten befreit. 1343 erwerben die Zisterzienserinnen zudem von denen von Hundelshausen Haus und Hof bei dem boyneburgischen Haus sowie einen Hof uf dem grabin vor dem handirthore, der bis zur Auflösung des Klosters als Wirtschaftshof genutzt wird.
- Die Herren von Dieden zum Fürstenstein verfügen als landgräfliche Burgmannen über zwei Burgsitze in Eschwege.
- Die Herren von Eschwege mit ihren drei Linien zu Aue, zu Jestädt und zu Reichensachsen, verfügen als landgräfliche Burgmannen über Burgsitze am Schulberg.
- Die Boyneburger haben mit ihren Linien zu Reichensachen, Netra und Jestädt Besitzungen in Eschwege.
- Die Herren von Keudell bzw. die Keudell zum Keudelstein verfügen als landgräfliche Burgmannen über einen Burgsitz in Eschwege.
- Kirche und Religion ↑
-
Ortskirchen:
- Drei Pfarrkirchen:
- a) St. Dionysius (Altstädter- oder Marktkirche) 1236 [ecclesia matrix Eckhardt, Rechtsgeschichte der Stadt Eschwege 1, S. 25-26, Nr. 24], dreischiffige gotische Hallenkirche mit archäologisch nachgewiesenen Vorgängerbauten und ursprünglich freistehendem Westturm aus dem 13. Jahrhundert
- b) Godehard (Nikolai), die ursprüngliche Godehardkirche 1340 zur Pfarrkirche erhoben, nach der Reformation abgebrochen, Nikolaiturm noch erhalten (Nikkolaiplatz)
- c) St. Katharina (Neustadt) 1340 erwähnt, 1354 Turmbau begonnen, gesamte Bau als dreischiffige gotische Hallenkirche 1520 vollendet. 1862/63 neugotische Umgestaltung durch Georg Gottlob Ungewitter
- Katholische Kirche St. Elisabeth (Moritz-Werner-Str. 2), Neuromanische Basilika von Theodor Großklaus 1904/05 errichtet
- Katholische Apostelkirche auf dem Heuberg 1967 geweiht
- Evangelische Kreuzkirche (Neubaugebiet auf der Struth) 1951 geweiht
- Evangelische Auferstehungskirche 1961 auf dem Heuberg errichtet
- Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Eschwege (Baptisten)
- Kirche der Landeskirchlichen Gemeinschaft
- Neuapostolische Kirche seit 1920 in Eschwege, seit 1954 in der ehemaligen Synagoge
-
Patrozinien:
- Dionysius (1340) [Klosterarchive 1: Klöster an der Werra, S. 30-31, Nr. 62-63]
- Katharina (1340)
- Godehardus (1340)
- Nikolaus und Godehard (1524)
-
Pfarrzugehörigkeit:
Zunächst umfasst die Altstädter- oder Marktkirche die gesamte Stadt. Mit der Errichtung von St. Katharina und St. Godehardus 1340 wird St. Dionysius auf einen östlichen Teil Altstadt beschränkt, während Godehardus den westlichen Teil mit Schloss abdeckt, St. Katharina die Neustadt. Nach der Reformation ist St. Dionysius wieder für die gesamte Altstadt zuständig.
-
Patronat:
Seit der Gründung gehört die Pfarrkirche St. Dionysius zum Cyriakusstift, dem sie 1380 inkorporiert wird. Auch St. Godehardus und St. Katharina gehören ursprünglich zum Stift. Nach der Reformation haben die Landgrafen von Hessen alle Patronatsrecht inne.
-
Klöster:
-
Beginen:
1305 und 1334 nachgewiesen, neben dem Augustinerhof
-
Diakonische Einrichtung:
15.01.1894 zwei Schwestern vom Vaterländischen Frauenverein angestellt; Betreuung von Jungfrauenverein, Mütterverein, Flickschule, Krankenpflege Rudolf Francke, Die christliche Liebestätigkeit in Kurhessen. Kassel 1904; 1913 vier Schwestern Wohnung im Hospital; Landkrankenhaus Eschwege - ab 1910 Diakonissen im Haus – neben Vinzentinerinnen Sardemann, Geschichte des hessischen Diakonissenhauses zu Cassel, S. 275 ff.; 1925 Aufbau einer neuen Diakonissenstation; fünf Schwestern betreuen seit 1933 auch das Städtische Altenheim (Arnold, Kirche in der Region Werra-Meißner, S. 147); Kleinkinderschule von Stadt unterhalten; Gemeindestation besteht bis 1989 (Landeskirchliches Archiv Kassel, Findbuch G 2.6. Kurhessisches Diakonissenhaus)
-
Bekenntniswechsel:
Erster evangelischer Pfarrer: Reinhard Borckhoff 1530(?)-1541, Pfarrer der Altstadt an St. Dionysius
Johannes Bethel gen. Spangenberg, Pfarrer ca. 1521-1528 an St. Katharina, hat möglicherweise vorübergehend evangelisch gepredigt, blieb jedoch katholisch.
-
Kirchliche Mittelbehörden:
1500: Mainzer Kirchenprovinz, Erzdiözise Mainz, Archidiakonat Heiligenstadt
Die Klasse Eschwege umfasste die Pfarreien Altenburschla, Datterode, Eschwege, Grandenborn, Grebendorf, Jestädt, Lüderbach, Netra, Niddawitzhausen, Niederdünzebach, Niederhone, Rambach, Reichensachsen, Renda, Röhrda, Schwebda, Völkershausen, Wanfried und Willershausen (Reimer).
-
Juden:
Provinzial-Rabbinat Kassel; 1580: 30: 1637: 12 Schutzjuden (Familien); 1744: 25; 1771: 171; 1812: 33 Familien; 1835: 236; 1855: 369; 1861: 470; 1871: 509; 1895: 487; 1905: 517; 1925: 433; 1932/33: 390 (3,00% der Gesamtbevölkerung)
1367 Ersterwähnung? 1295 soll es bereits Judenverfolgungen gegeben haben.
bis 1637 existierte eine "juddengaßen" (Stadtzentrum zwischen Kohlmarkt/Steinweg)
vom 16 bis ins 20. Jahrhundert lebten Juden im Ort; nach 1933 verließen viele den Ort, viele wurden 1941/42 deportiert.
Synagoge: nach 1687 errichtet "Am Fischatadel"; zuvor baufälliger Betraum genutzt; 1838: Synagoge "Auf dem Cyriaksberg" errichtet und geweiht (134 Männer- und 74 Frauenplätze); nach 1945 wird das Gebäude von der Neuapostolischen Gemeinde genutzt.
1825: Synagogenordnung erlassen
seit ca. 1839 jüdische Volksschule; stetiger Rückgang der Schülerzahlen um Jahrhundertwende, endgültige Schließung 1939, bis Mai 1940 noch als Privatschule genutzt
Berufe: Viehhandel, Handel
bis 1860 Sammelfriedhof in Jestädt genutzt, seitdem eigener Friedhof (alemannia-judaica)
- Kultur ↑
-
Schulen:
1340 Schule des Stifts; 1527 Neugründung als Lateinschule durch Landgraf Philipp, Rektor der Stadtschule: Petrus Nigidius 1521, Conrad Clericus ca. 1520- ca. 1540; 1655 Stadtschule mit sechs Klassen und 218 Schülern; ab 1823 Volksschule; 1910 bestehen mehrere Volksschulen mit 29 Klassen
im 17./18. Jahrhundert private Schulen für Mädchen; seit 1827 Städtische Bürgermädchenschule; 1851 Private Töchtersschule, ab 1863 Ausbau zur Städtischen Mädchenmittelschule; 1908 Städtisches Lyzeum; ab 1926 Staatliches Mädchengymnasium
1837-1938 und nach Kriegsende 1945 Katholische Volksschule; 1957 drei Volksschulen
vor 1838 Privates Progymnasium, wird ab 1840 ausgebaut zum Städtischen Realgymnasium
1859 Präparandenschule, 1908 Staatliche Präparandenanstalt, 1911-1926 Staatliches Lehrerseminar
1832 Städtische Handwerkerschule, 1887 Handelsschule, 1907 Landwirschaftsschule; 1934 Zusammenlegung aller Beuflichen Schulen zur Kreisberufsschule
-
Hospitäler:
1340 Gründung des Hospitals St. Elisabeth, 1559 Ausstattung mit säkularisiertem Klosterbesitz
1326 Errichtung eines Siechenhauses am rechten Werraufer, 1912 renoviert (Ritter, Kirchliches Handbuch, S. 28)
-
Sprachgeschichte (Quellenfaksimiles):
-
Historische Ereignisse:
1250 Eroberung der regia villa Eschwege am 29.12.1250 und der Vertreibung der Parteigänger Markgraf Heinrichs des Erlauchten von Meißen durch Herzog Otto von Braunschweig
1637 Zerstörung durch Kroaten
- Wirtschaft ↑
-
Mittelpunktfunktion:
Das Amt Eschwege umfasste 1585 (Der ökonomische Staat) außer der Stadt und den Dörfern Frieda und Grebendorf noch die Gerichte Abterode, Germerode, Boyneburg, die adligen Dörfer Oberdünzebach und Niederdünzebach, Langenhain, Aue, Schwebda, Völkershausen, Niddawitzhausen, Albungen, Wipperode, Hattenrode, Hof Vogelsburg und die einzelnen Höfe Oberndorf, Mönchhof und Hof Wölfterode (Reimer).
-
Wirtschaft:
Wirtschaftszentrum des Werralandes; Gewandschneiderrechte und -zunftbrief 1340; Wollweberei - Gildebrief von 1347; Entwicklung einer bedeutenden Tuchherstellung; im 18. Jahrhundert Seifensieder und Töpfer genannt; 1845 Fabrik für Wolltuchweberei; 1862 noch 220 Tuchmachermeister, davon 60 selbständig mit 300 Gesellen und 120 Arbeiterinnen; daneben Leinweberei, Garnspinnereri, 1864 Wirkwarenfabrik; Gerbereien, Schuhfabriken, Filz- und Hutmacher; um 1860 Haupthandelsgüter Tuche, Garne, Schuhe, Leder, Fleisch- und Wurstwaren, Tabak
-
Mühlen:
1769 1 Mahl-, 2 Walke-, 3 Loh- und 2 Schlagmühlen
um 1859 2 fürstliche Mahlmühlen und 2 Walk-, 2 Lehm- und 3 Ölmühlen
Die Mühlen befanden sich an der Werra bzw. der Werrainsel am Südarm des Flusses. Kollmann, Von Wind und Wasser gedreht (s. Literatur) führt im einzelnen auf: Deckertsche Lohmühle, Kleine Lohmühle, Walkmühle, 4 ohne Namen, Mühlen des Cyriacusstifts, Neue Mühle, Mühle vor dem Boyneburger Tor, Schlierbachsmühle
-
Markt:
1188 hat das Cyriakusstift das Marktrecht in Eschwege inne.
4 Jahrmärkte, seit 1608 6, davon 2 mit Viehmärkten verbunden.
1769 werden 6 Märkte für die Altstadt genannt: 1. Mittwoch nach Iudaica (Sonntag von Ostern), der Ostermarkt genannt, 2. Mittwoch vor oder nach Walburgi (1. Mai), 3. Mittwoch nach Trinitatis (Sonntag nach Pfingsten), 4. Mittwoch nach Laurentius (10. August), 5. Mittwoch nach Egidius (1. September), 6. Mittwoch nach Nikolaus (6. Dezember). Der Markt wird von Kaufleuten aus Thüringen und Sachsen besucht. Die Märkte in der Neustadt finden seit dem 30jährigen Krieg nicht mehr statt.
-
Münze:
Ältester Eschweger Pfennig um 1150. Das Münzrecht ist nachweislich 1188 in den Händen des Cyriakusstifts.
- Nachweise ↑
-
Literatur:
- Eschwege-Lexikon
- Seim, Reformation und Stadtverfassung, S. 28-29
- Arnold, Kirche in der Region Werra-Meißner, S. 80-81
- Geschichte der Stadt Eschwege
- Die deutschen Königspfalzen, Band 1, Lfg. 1, S. 98-112, und Die deutschen Königspfalzen, Band 1, Lfg. 2, S. 113-130.
- Denkmaltopographie Werra-Meißner-Kreis, Stadt Eschwege, S. 10 - 411 (Einführung S. 10 - 47; Kernstadt S. 47 - 289)
- Fundberichte 1986, S. 512 (AG Eschwege, LfD) > 5 x Einzelfunde
- Fundberichte 1996, S. 397 f. (7 x AG Eschwege u. 2 x LfD) > Funde in Stadt und Gemarkung
- K. Kollmann, Von Wind und Wasser gedreht, Teil 10, Schlossmühle Eschwege
- K. Kollmann, Von Wind und Wasser gedreht, Teil 11, Die Mühlen auf dem Steinernen Wehr in Eschwege
- K. Kollmann, Von Wind und Wasser gedreht, Teil 12, Weitere Eschweger Mühlen
- Scholz, Wasser- und Windmühlen Werra-Meißner-Kreis, S. 44-47
- Knappe, Burgen in Hessen, S. 63 f.
- Heinemeyer, Königshof Eschwege
- Karl G. Bruchmann, Kreis Eschwege
- Historisches Ortslexikon Kurhessen, S. 131 f. (Ort, Klasse, Amt)
- Hütteroth, althessische Pfarrer, S. 23, 495.
- W. Eckhardt, Eschwege 1769
- Germania Judaica 3/1, S. 332.
- Arnsberg, Die jüdischen Gemeinden in Hessen: Anfang, Untergang, Neubeginn, Bd. 1, S. 167ff., S. 419.
- Hessisches Städtebuch, S. 109-112
- Dersch, Klosterbuch, S. 21
- Zitierweise ↑
- „Eschwege, Werra-Meißner-Kreis“, in: Historisches Ortslexikon <https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/ol/id/5631> (Stand: 17.1.2024)